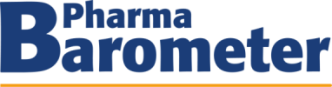− Die wichtigsten Ergebnisse aus den Teilanalysen der Phase-3-Studie ALTA 1L belegen weiterhin die starke intrakranielle Wirksamkeit von ALUNBRIG und die Verbesserung der Lebensqualität in der Erstlinientherapie bei ALK+ NSCLC
− Positive Folgedaten über 10 Monaten aus der Phase-1/2-Studie bestätigen die zuvor gemeldeten Ergebnisse über Mobocertinib bei Patienten mit EGFR-Exon-20-insertionspositivem metastasiertem NSCLC
CAMBRIDGE (Mass./USA) und OSAKA (Japan)–(BUSINESS WIRE)–Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) („Takeda“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf dem virtuellen Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) Daten aus seinem Lungenkrebs-Portfolio präsentiert. Insbesondere die Erkenntnisse aus den Teilanalysen der Phase-3-Studie ALTA 1L bekräftigen zum einen die überzeugenden Beweise für die intrakranielle Wirksamkeit von ALUNBRIG® (Brigatinib) als Erstlinienbehandlung von Patienten mit anaplastischem Lymphom-Kinase-positivem (ALK+), nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und zum anderen die damit verbundenen Daten zur Lebensqualität (QoL). Darüber hinaus stellt Takeda auch aktualisierte Folgeergebnisse über einen Zeitraum von 10 Monaten aus der Phase-1/2-Studie zu Mobocertinib (TAK-788) vor. Diese Daten zeigen, dass Mobocertinib in der Studienpopulation von Patienten mit EGFR-Exon-20-insertionspositivem metastasiertem NSCLC (mNSCLC) eine Ansprechdauer von mehr als einem Jahr erreichen konnte.
„Wir freuen uns, auf dem diesjährigen virtuellen ESMO-Kongress unsere laufenden Forschungsarbeiten über Lungenkrebs präsentieren zu können. Dazu zählen neue Ergebnisse aus unserer laufenden Phase-3-Studie ALTA 1L, die die Überlegenheit von ALUNBRIG gegenüber Crizotinib bekräftigen und die Aussagekraft der Daten unterstreichen, auf deren Grundlage ALUNBRIG seine jüngste Indikation für die Erstbehandlung in den USA und in der Europäischen Union erhielt“, so Christopher Arendt, Leiter der Oncology Therapeutic Area Unit von Takeda. „Darüber hinaus zeigten aktualisierte Daten aus der Phase-1/2-Studie mit Mobocertinib eine verlängerte Ansprechdauer bei Patienten mit EGFR-Exon20-insertionspositivem mNSCLC. Dies stellt einen vielversprechenden Fortschritt für eine unterversorgte Population dar, die von den derzeit verfügbaren Behandlungen nur eine begrenzte Wirksamkeit erwarten kann.“
Die Ergebnisse der Teilanalysen aus der Phase-3-Studie ALTA 1L, die in zwei Postersitzungen vorgestellt werden, geben zusätzliche Einblicke in die intrakranielle Wirksamkeit von ALUNBRIG und die Verbesserung der Lebensqualität in der Erstlinienbehandlung. ALUNBRIG hat die Zeit bis zum intrakraniellen Fortschreiten der Krankheit im Vergleich zu Crizotinib bei Patienten mit ALK-Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI)-naivem ALK-positivem NSCLC signifikant verlängert und eine robuste intrakranielle Aktivität bewiesen. Bei der Bewertung von Patienten mit Hirnmetastasen zu Studienbeginn kam ein verblindetes unabhängiges Review-Komitee (BIRC) zu den folgenden wichtigen Ergebnissen:
- Bei Patienten, die mit ALUNBRIG behandelt wurden, vergingen durchschnittlich 24 Monate (12,9-NR) bis zur intrakraniellen Progression der Krankheit im Vergleich zu 5,6 Monaten bei Crizotinib (4,0–9,2).
- ALUNBRIG bewies bei Patienten, die keine vorherige Bestrahlung des Gehirns erhalten hatten, mit einer durchschnittlichen Dauer von 24 Monaten gegenüber 5,5 Monaten bei Crizotinib (Risikoquotient [HR]: 0,27, P=0,0003) eine signifikante Verbesserung des progressionsfreien Gesamtüberlebens (PFS).
- Das Gehirn war bei mit ALUNBRIG behandelten Patienten im Vergleich zur Behandlung mit Crizotinib seltener der erste Ort der Krankheitsprogression (ALUNBRIG: 31 Prozent; Crizotinib: 42 Prozent).
- ALUNBRIG zeigte weiterhin Verbesserungen des allgemeinen Gesundheitszustands (GHS)/ der Lebensqualität im Vergleich zu Crizotinib. Die Behandlung verzögerte die Zeit bis zur Verschlechterung des Zustands von Patienten mit Hirnmetastasen bei Studienbeginn beträchtlich (16,6 Monate gegenüber 4,7 Monaten bei Crizotinib [HR: 0,54, 95 % KI 0,29‒1,00; P=0,0415]).
- Schwere unerwünschte Reaktionen traten bei 33 Prozent der mit ALUNBRIG behandelten Patienten auf. Die häufigsten schweren unerwünschten Reaktionen neben dem Fortschreiten der Krankheit waren Pneumonie (4,4 %), ILD/Pneumonitis (3,7 %), Fieber (2,9 %), Atemnot (2,2 %), Lungenembolie (2,2 %) und Asthenie (2,2 %). Tödliche unerwünschte Reaktionen neben dem Fortschreiten der Krankheit traten bei 2,9 Prozent der Patienten auf und umfassten Pneumonie (1,5 %), Schlaganfall (0,7 %) und multiples Organversagen (0,7 %).
„Die laufenden Ergebnisse der Studie ALTA 1L zeigen, dass Brigatinib eine wirksame Erstlinienbehandlung für ALK-positive NSCLC-Patienten darstellt, insbesondere für Patienten mit Hirnmetastasen zu Studienbeginn“, so Professor Sanjay Popat, Consultant Medical Oncologist, The Royal Marsden NHS Foundation Trust. „Zwar stehen uns jetzt mehrere gezielte Behandlungsoptionen zur Verfügung, um die Krankheit zu behandeln. Es haben sich jedoch Therapien, die eine robuste intrakranielle Wirksamkeit gezeigt haben, als unschätzbare Ergänzung beim Versuch erwiesen, das Leben unserer Patienten zu verlängern und zu verbessern.“
Es werden auch die wichtigsten Ergebnisse einer mündlichen On-Demand-Mini-Sitzung vorgestellt, die die Ergebnisse der Phase-1/2-Studie mit Mobocertinib mit einer Nachbeobachtungszeit von 10 Monaten enthält. Bestätigte Responder, die mit Mobocertinib behandelt wurden, sprachen im Durchschnitt mehr als ein Jahr lang an, mit einer medianen Ansprechdauer von 13,9 Monaten (5,0-NR). Mit zusätzlicher Nachbeobachtung konnte die Studie eine bestätigte objektive Ansprechrate von 43 Prozent (12/28; 95 % KI 24-63) und ein medianes progressionsfreies Überleben von 7,3 Monaten (95 % KI 4,4-15,6) unter sämtlichen behandelten Patienten aufrechterhalten. Das Sicherheitsprofil von Mobocertinib war überschaubar. Bei Patienten mit EGFR-Exon20-insertionspositivem mNSCLC, die mit der einmal täglichen Dosis von 160 mg behandelt wurden, waren die häufigsten unerwünschten Reaktionen (≥25 %) Durchfall (89 %), verminderter Appetit (54 %), Erbrechen (54 %), Hautausschlag (46 %), Übelkeit (46 %) und Anämie (36 %). Unter allen Patienten, die mit der einmal täglichen Dosis von 160 mg behandelt wurden, waren die häufigsten behandlungsbedingten unerwünschten Reaktionen (TRAE) Durchfall (88 %), Übelkeit (49 %), Erbrechen (36 %) und Hautausschlag (35 %).
Daten aus EXCLAIM, der zulassungsrelevanten Verlängerungskohorte der Phase-2-Studie für Mobocertinib, werden im Geschäftsjahr 2020 bekanntgegeben.
Über ALUNBRIG® (Brigatinib)
ALUNBRIG ist ein hochwirksamer und selektiver Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI) der nächsten Generation, der auf molekulare Veränderungen der anaplastischen Lymphomkinase (ALK) abzielen soll.
ALUNBRIG ist in den USA und in der Europäischen Union (EU) als Erstlinienbehandlung für Patienten mit ALK-positivem (ALK+) metastasiertem NSCLC zugelassen, die zuvor nicht mit einem ALK-Inhibitor behandelt wurden. ALUNBRIG ist auch in mehr als 40 Ländern zugelassen, darunter in den USA, in Kanada und in der Europäischen Union, zur Behandlung von Patienten mit ALK-positivem metastasiertem NSCLC, die mit Crizotinib behandelt wurden, deren NSCLC sich jedoch verschlechtert hat oder die Crizotinib nicht vertragen.
Über den ALK-positiven NSCLC
Der nicht-kleinzellige Lungenkrebs (NSCLC) ist die häufigste Form des Lungenkrebses. Auf ihn entfallen etwa 85 Prozent der geschätzten 1,8 Millionen von neuen Fälle von Lungenkrebs, die laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedes Jahr weltweit diagnostiziert werden.1,2 Genetische Studien ergaben Hinweise darauf, dass bei einer Untergruppe von NSCLC-Patienten auch chromosomale Rearrangements mit Auswirkung auf die anaplastische Lymphomkinase (ALK) eine wichtige Rolle spielen.3 Ungefähr drei bis fünf Prozent der Patienten mit metastasiertem NSCLC weisen ein Rearrangement im ALK-Gen auf.4,5,6 Der ALK-positive NSCLC ist eine komplexe und vielschichtige Krankheit, die für große Herausforderungen bei der Behandlung von neu diagnostizierten Patienten sorgt, insbesondere bei jenen, bei denen sich die Krankheit auf das Gehirn ausgebreitet hat.
Takeda sieht es als seine Aufgabe an, die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zum NSCLC fortzusetzen, um die Lebensqualität der weltweit etwa 40.000 Patienten, bei denen jedes Jahr diese schwere und seltene Form des Lungenkrebses diagnostiziert wird, zu verbessern.7
Über Mobocertinib (TAK-788)
Mobocertinib ist ein potenter, kleinmolekularer Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI), der speziell für die selektive Bekämpfung von Insertionsmutationen des epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptors (EGFR) und von humanen EGFR-2-(HER2)-Exon-20-Insertionsmutationen entwickelt wurde. Im Jahr 2019 erteilte die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA Mobocertinib den Orphan-Drug-Status für die Behandlung von Lungenkrebs mit HER2-Mutationen oder EGFR-Mutationen, einschließlich Exon-20-Insertionsmutationen. Im April 2020 erhielt Mobocertinib von der FDA den Status einer Breakthrough Therapy für die Behandlung von Patienten mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (mNSCLC) mit EGFR-Insertionsmutationen im Exon 20, deren Krankheit im Verlauf oder nach einer platinbasierten Chemotherapie fortgeschritten ist.
Das Entwicklungsprogramm für Mobocertinib war zunächst auf die NSCLC-Population ausgerichtet und wird voraussichtlich auf weitere unterversorgte Populationen anderer Tumorarten erweitert. Mobocertinib ist ein experimenteller Wirkstoff, dessen Wirksamkeit und Sicherheit noch nicht nachgewiesen sind.
Über EGFR-Exon-20-insertionspositiven mNSCLC
Patienten mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen und metastasiertem nicht kleinzelligem Lungenkrebs (mNSCLC) machen nur etwa 1 bis 2 Prozent der Patienten mit NSCLC aus.8,9 Diese Erkrankung hat eine ungünstigere Prognose als andere EGFR-Mutationen, da zurzeit keine von der FDA zugelassenen Therapien existieren, die auf Exon-20-Mutationen abzielen, und heutige EGFR-TKI und Chemotherapien nur einen begrenzten Nutzen für diese Patientengruppe bieten.
Takeda sieht es als seine Aufgabe an, die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen bei EGFR-Exon-20-insertionspositivem mNSCLC fortzusetzen, und hofft, eine gezielte Behandlungsoption für die etwa 30.000 Patienten, bei denen jedes Jahr diese Krankheit diagnostiziert wird, einzuführen.8,9
ALUNBRIG – WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN
Interstitielle Lungenerkrankung (ILD)/Pneumonitis: Schwere, lebensbedrohliche und tödliche Lungennebenwirkungen im Sinne einer interstitiellen Lungenerkrankung (ILD)/Pneumonitis sind unter der Einnahme von ALUNBRIG aufgetreten. Im ALUNBRIG-Arm der Studie ALTA 1L (180 mg einmal täglich) trat eine ILD/Pneumonitis bei 5,1 % der Patienten mit ALUNBRIG-Behandlung auf. Die ILD/Pneumonitis trat innerhalb von 8 Tagen nach Einleitung der Behandlung mit ALUNBRIG bei 2,9 % der Patienten auf, wobei Nebenwirkungen 3. und 4. Grades bei 2,2 % der Patienten beobachtet wurden. In der Studie ALTA trat eine ILD/Pneumonitis bei 3,7 % der Patienten in der 90-mg-Gruppe (90 mg einmal täglich) und bei 9,1 % der Patienten in der 90→180-mg-Gruppe (180 mg einmal täglich mit einer 7-tägigen Einleitungsphase mit 90 mg einmal täglich) auf. Die Nebenwirkungen im Sinne einer möglichen ILD/Pneumonitis traten frühzeitig innerhalb von 9 Tagen nach Einleitung der Behandlung mit ALUNBRIG (medianer Beginn: 2 Tage) bei 6,4 % der Patienten auf, wobei Nebenwirkungen 3. und 4. Grades bei 2,7 % beobachtet wurden. Patienten sind hinsichtlich des Neuauftretens oder der Verschlechterung von Atembeschwerden (z. B. Atemnot, Husten etc.) zu überwachen, insbesondere während der ersten Woche nach Einleitung der Behandlung mit ALUNBRIG. Die Behandlung mit ALUNBRIG ist bei allen Patienten mit neu aufgetretenen oder sich verschlechternden Atembeschwerden auszusetzen, und eine Abklärung hinsichtlich ILD/Pneumonitis oder anderer Ursachen der Atembeschwerden (z. B. Lungenembolie, Tumorprogression und infektiöse Pneumonie) muss umgehend erfolgen. Bei ILD/Pneumonitis 1. oder 2. Grades entweder die Behandlung mit ALUNBRIG mit reduzierter Dosis nach Erholung bis zum Ausgangszustand wiederaufnehmen oder ALUNBRIG dauerhaft absetzen. Bei ILD/Pneumonitis 3. oder 4. Grades oder Rezidiv der ILD/Pneumonitis 1. oder 2. Grades ist ALUNBRIG dauerhaft abzusetzen.
Hypertonie: Im ALUNBRIG-Arm der Studie ALTA 1L (180 mg einmal täglich) wurde über Hypertonie bei 32 % der Patienten berichtet, die ALUNBRIG erhielten. Hypertonie 3. Grades trat bei 13 % der Patienten auf. In der ALTA-Studie wurde über Hypertonie bei 11 % der Patienten in der 90-mg-Gruppe, die ALUNBRIG erhielten, und 21 % der Patienten in der 90→180-mg-Gruppe berichtet. Hypertonie 3. Grades trat insgesamt bei 5,9 % der Patienten auf. Vor Beginn der Behandlung mit ALUNBRIG ist eine Kontrolle des Blutdrucks erforderlich. Während der Behandlung mit ALUNBRIG ist der Blutdruck nach 2 Wochen und danach mindestens einmal im Monat zu überwachen. Bei Auftreten einer Hypertonie 3. Grades trotz optimaler antihypertensiver Therapie ist die Behandlung mit ALUNBRIG auszusetzen. Bei Normalisierung des Blutdrucks oder Verbesserung auf Grad 1 ist die Behandlung mit ALUNBRIG mit derselben Dosis wieder aufzunehmen. Bei Hypertonie 4. Grades oder Wiederauftreten einer Hypertonie 3. Grades ist das dauerhafte Absetzen der Behandlung mit ALUNBRIG zu erwägen. Bei Verabreichung von ALUNBRIG in Kombination mit Antihypertensiva, die eine Bradykardie verursachen, ist Vorsicht angezeigt.
Bradykardie: Im ALUNBRIG-Arm der Studie ALTA 1L (180 mg einmal täglich) fanden sich Herzfrequenzen von weniger als 50 Schlägen pro Minute bei 8,1% der Patienten, die ALUNBRIG erhielten. Eine Bradykardie 3. Grades trat bei 1 (0,7 %) der Patienten auf. In der ALTA-Studie fanden sich Herzfrequenzen von weniger als 50 Schlägen pro Minute bei 5,7 % der Patienten in der 90-mg-Gruppe und 7,6 % der Patienten in der 90→180-mg-Gruppe. Eine Bradykardie 2. Grades trat bei 1 (0,9 %) Patienten in der 90-mg-Gruppe auf. Während der Behandlung mit ALUNBRIG sind die Herzfrequenz und der Blutdruck zu überwachen. Lässt sich die gleichzeitige Behandlung mit einem Medikament, das bekanntermaßen eine Bradykardie verursachen kann, nicht vermeiden, sind die Patienten engmaschiger zu überwachen. Bei symptomatischer Bradykardie ist die Behandlung mit ALUNBRIG auszusetzen und die Begleitmedikation auf Wirkstoffe zu überprüfen, die bekanntermaßen eine Bradykardie verursachen können. Wenn eine Begleitmedikation, die bekanntermaßen eine Bradykardie verursachen kann, erkannt und abgesetzt oder in der Dosierung angepasst wurde, ist die Behandlung mit ALUNBRIG nach Abklingen der symptomatischen Bradykardie in derselben Dosierung wieder aufzunehmen; andernfalls ist die ALUNBRIG-Dosis nach Abklingen der symptomatischen Bradykardie zu reduzieren. Bei lebensbedrohlicher Bradykardie ist ALUNBRIG abzusetzen, wenn keine mitverantwortliche Begleitmedikation gefunden wird.
Sehstörungen: Im ALUNBRIG-Arm der Studie ALTA 1L (180 mg einmal täglich) wurden Nebenwirkungen 1. oder 2. Grades, die zu Sehstörungen, darunter Verschwommensehen, Photophobie, Photopsie und herabgesetzte Sehschärfe führen, bei 7,4 % der mit ALUNBRIG behandelten Patienten berichtet. In der ALTA-Studie wurden Nebenwirkungen, die zu Sehstörungen, darunter Verschwommensehen, Doppeltsehen und herabgesetzte Sehschärfe führen, bei 7,3 % der mit ALUNBRIG behandelten Patienten in der 90-mg-Gruppe und 10 % der Patienten in der 90→180-mg-Gruppe berichtet. Ein Makulaödem 3. Grades und Katarakt traten bei jeweils einem Patient in der 90→180-mg-Gruppe auf. Patienten sind darauf hinzuweisen, Sehbeschwerden zu melden. Bei Auftreten neuer oder Verschlechterung bestehender Sehbeschwerden 2. oder höheren Grades ist die Behandlung mit ALUNBRIG auszusetzen und eine augenärztliche Untersuchung durchzuführen. Bei Abklingen von Sehbeschwerden 2. oder 3. Grades auf Grad 1 oder Ausgangswert ist die Behandlung mit ALUNBRIG in einer niedrigeren Dosis wieder aufzunehmen. Bei Auftreten von Sehstörungen 4. Grades ist die Behandlung mit ALUNBRIG dauerhaft abzubrechen.
Creatinphosphokinase (CPK)-Erhöhung: Im ALUNBRIG-Arm der Studie ALTA 1L (180 mg einmal täglich) trat bei 81 % der mit ALUNBRIG behandelten Patienten eine Erhöhung der Creatinphosphokinase (CPK) auf. Die Inzidenz einer CPK-Erhöhung 3. oder 4. Grades betrug 24 %. Eine Dosisreduktion wegen CPK-Erhöhung erfolgte bei 15 % der Patienten. In der ALTA-Studie trat bei 27 % der mit ALUNBRIG behandelten Patienten in der 90-mg-Gruppe und 48 % der Patienten in der 90→180-mg-Gruppe eine CPK-Erhöhung auf. Die Inzidenz einer CPK-Erhöhung 3. oder 4. Grades betrug 2,8 % in der 90-mg-Gruppe und 12 % in der 90→180-mg-Gruppe. Eine Dosisreduktion wegen CPK-Erhöhung erfolgte bei 1,8 % der Patienten in der 90-mg-Gruppe und bei 4,5 % in der 90→180-mg-Gruppe. Patienten sind aufzufordern, unerklärliche Muskelschmerzen, -empfindlichkeit oder -schwäche zu berichten. Während der ALUNBRIG-Behandlung ist der CPK-Spiegel zu überwachen. Die Behandlung mit ALUNBRIG ist bei CPK-Erhöhungen 3. oder 4. Grades bei Muskelschmerzen oder -schwäche 2. Grades oder höher auszusetzen. Bei Normalisierung oder Absinken auf CPK-Erhöhung 1. Grades oder auf den Ausgangswert ist die Behandlung mit ALUNBRIG mit derselben oder einer reduzierten Dosis wieder aufzunehmen.
Erhöhung der Pankreasenzyme: Im ALUNBRIG-Arm der Studie ALTA 1L (180 mg einmal täglich) wurde eine Amylase-Erhöhung bei 52 % der Patienten und eine Amylase-Erhöhung 3. oder 4. Grades bei 6,8 % der Patienten beobachtet. Lipase-Erhöhungen traten bei 59 % der Patienten auf. Lipase-Erhöhungen 3. oder 4. Grades traten bei 17 % der Patienten auf. In der ALTA-Studie wurde eine Amylase-Erhöhung bei 27 % der Patienten in der 90-mg-Gruppe und 39 % der Patienten in der 90→180-mg-Gruppe beobachtet. Lipase-Erhöhungen traten bei 21 % der Patienten in der 90-mg-Gruppe und 45 % der Patienten in der 90→180-mg-Gruppe auf. Amylase-Erhöhungen 3. oder 4. Grades wurden bei 3,7 % der Patienten in der 90-mg-Gruppe und bei 2,7 % der Patienten in der 90→180-mg-Gruppe festgestellt. Lipase-Erhöhungen 3. oder 4. Grades traten bei 4,6 % der Patienten in der 90-mg-Gruppe und bei 5,5 % der Patienten in der 90→180-mg-Gruppe auf. Während der Behandlung mit ALUNBRIG sind die Lipase- und Amylase-Werte zu überwachen. Die Behandlung mit ALUNBRIG ist bei Pankreasenzymerhöhung 3. oder 4. Grades auszusetzen. Bei Normalisierung oder Absinken auf Grad 1 oder Ausgangswert, ist die Behandlung mit ALUNBRIG mit derselben oder einer reduzierten Dosis wieder aufzunehmen.
Hyperglykämie: Im ALUNBRIG-Arm der Studie ALTA 1L (180 mg einmal täglich) wurden bei 56 % der mit ALUNBRIG behandelten Patienten das Neuauftreten oder die Verschlechterung einer Hyperglykämie beobachtet. Eine Hyperglykämie 3. Grades, die durch eine Laboruntersuchung des Nüchtern-Blutzuckerwerts im Serum ermittelt wurde, trat bei 7,5 % der Patienten auf. In der ALTA-Studie wurden bei 43 % der Patienten, die ALUNBRIG erhielten, das Neuauftreten oder die Verschlechterung einer Hyperglykämie beobachtet. Eine Hyperglykämie 3. Grades, die durch eine Laboruntersuchung des Nüchtern-Blutzuckerwerts im Serum ermittelt wurde, trat bei 3,7 % der Patienten auf. Bei zwei von 20 (10 %) Patienten mit Diabetes oder Glukoseintoleranz bei Studienbeginn musste während der ALUNBRIG-Behandlung eine Insulinbehandlung eingeleitet werden. Vor Beginn der ALUNBRIG-Behandlung ist der Nüchtern-Blutzuckerwert im Serum zu bestimmen und danach in regelmäßigen Abständen zu überwachen. Bei Bedarf ist eine Behandlung mit blutzuckersenkenden Medikamenten einzuleiten oder zu optimieren. Wenn trotz optimaler Therapie eine ausreichende Kontrolle von Hyperglykämien nicht erreicht werden kann, ist die ALUNBRIG-Behandlung auszusetzen, bis eine ausreichende Kontrolle von Hyperglykämien erreicht ist. Eine Reduktion der ALUNBRIG-Dosis oder ein dauerhaftes Absetzen von ALUNBRIG ist in Betracht zu ziehen.
Embryofetale Toxizität: Der Wirkmechanismus und Beobachtungen bei Tieren sprechen dafür, dass ALUNBRIG bei Anwendung in der Schwangerschaft Schädigungen des Ungeborenen verursachen kann. Es liegen keine klinischen Daten zur Anwendung von ALUNBRIG in der Schwangerschaft vor. Schwangere sind auf das potenzielle Risiko für das Ungeborene hinzuweisen. Gebärfähigen Frauen ist anzuraten, während der Behandlung mit ALUNBRIG eine wirksame nicht-hormonelle Verhütungsmethode zu verwenden und diese für mindestens 4 Monate nach Gabe der letzten Dosis beizubehalten. Männern mit Partnerinnen im gebärfähigen Alter ist anzuraten, während der Behandlung mit ALUNBRIG und mindestens 3 Monate nach der letzten ALUNBRIG-Dosis wirksame Methoden zur Schwangerschaftsverhütung anzuwenden.
UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN
In der Studie ALTA 1L traten schwere unerwünschte Reaktionen bei 33 % der mit ALUNBRIG behandelten Patienten auf. Die häufigsten schweren unerwünschten Reaktionen neben dem Fortschreiten der Krankheit waren Pneumonie (4,4 %), ILD/Pneumonitis (3,7 %), Fieber (2,9 %), Atemnot (2,2 %), Lungenembolie (2,2 %) und Asthenie (2,2 %). Tödliche unerwünschte Reaktionen neben dem Fortschreiten der Krankheit traten bei 2,9 % der Patienten auf und umfassten Pneumonie (1,5 %), Schlaganfall (0,7 %) und multiples Organversagen (0,7 %).
In der ALTA-Studie traten schwere unerwünschte Reaktionen bei 38 % der Patienten in der 90-mg-Gruppe und 40 % der Patienten in der 90→180-mg-Gruppe auf. Die häufigsten schweren unerwünschten Reaktionen waren Pneumonie (5,5 % gesamt, 3,7 % in der 90-mg-Gruppe und 7,3 % in der 90→180-mg-Gruppe) und ILD/Pneumonitis (4,6 % gesamt, 1,8 % in der 90-mg-Gruppe und 7,3 % in der 90→180-mg-Gruppe). Tödliche unerwünschte Reaktionen traten bei 3,7 % der Patienten auf und umfassten Pneumonie (2 Patienten), plötzlichen Tod, Atemnot, respiratorische Insuffizienz, Lungenembolie, bakterielle Meningitis und Urosepsis (jeweils 1 Patient).
Die häufigsten unerwünschten Reaktionen (≥ 25 %) bei ALUNBRIG waren Durchfall (49 %), Müdigkeit (39 %), Übelkeit (39%), Hautausschlag (38 %), Husten (37 %), Muskelschmerzen (34 %), Kopfschmerzen (31 %), Hypertonie (31 %), Erbrechen (27 %) und Atemnot (26 %).
WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN ARZNEIMITTELN
CYP3A-Inhibitoren: Die gleichzeitige Anwendung von ALUNBRIG mit starken oder mittelstarken CYP3A-Inhibitoren ist zu vermeiden. Auf Grapefruit oder Grapefruitsaft ist zu verzichten, da diese zu einem Anstieg des Brigatinib-Plasmaspiegels führen können. Wenn die gleichzeitige Anwendung eines starken oder mittelstarken CYP3A-Inhibitors unvermeidlich ist, ist die ALUNBRIG-Dosis zu senken.
CYP3A-Induktoren: Die gleichzeitige Anwendung von ALUNBRIG mit starken oder mittelstarken CYP3A-Induktoren ist zu vermeiden. Wenn die gleichzeitige Anwendung von mittelstarken CYP3A-Induktoren unvermeidlich ist, ist die ALUNBRIG-Dosis zu erhöhen.
CYP3A-Substrate: Die gemeinsame Verabreichung von ALUNBRIG mit sensitiven CYP3A-Substraten, darunter hormonelle Verhütungsmittel, kann zu herabgesetzten Konzentrationen und dem Verlust der Wirksamkeit von sensitiven CYP3A-Substraten führen.
Contacts
Medien:
Japanische Medien
Kazumi Kobayashi
kazumi.kobayashi@takeda.com
Tel.: +81 (0) 3-3278-2095
Medien anderer Länder
Lauren Padovan
lauren.padovan@takeda.com
Tel.: +1 (617) 444-1419