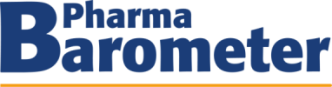Unternehmensverantwortung im Sinne des Global Compacts der Vereinten Nationen
Unternehmen, die Wert auf verantwortungsvolle geschäftliche, soziale und ökologische Standards legen und die die Menschenrechte in ihrem Einflussbereich nach Möglichkeit stärken und nicht schwächen wollen, finden in den zehn Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) zu Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und dem Kampf gegen Korruption hilfreiche und international breit abgestützte Leitlinien. Manager sollten den Status quo ihres Unternehmens anhand dieser Grundsätze und ihrer Interpretationen untersuchen, um Stärken zu erkennen, eventuelle Schwachstellen festzustellen und gegebenenfalls zu beseitigen.
Bei einer solchen Bestandesaufnahme, bei der Formulierung geeigneter Unternehmensrichtlinien und bei der Entwicklung leistungsstarker Mechanismen zu deren Einhaltung kann der Dialog strategisch wichtigen Anspruchsgruppen (stakeholder) wertvolle Beiträge leisten.
Den Kern aller unternehmerischen Tätigkeit bildet nach wie vor das Geschäftsergebnis – aber die „Regeln“ haben sich gewandelt.
Trotz seines schlechten Rufs hat der berühmte Leitsatz von Milton Friedman nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt: „The business of business is business“, d.h. der Kern aller unternehmerischen Tätigkeit bildet das Geschäft. Die Hauptaufgabe bleibt daher, dass „das Unternehmen seine Ressourcen und Aktivitäten mit dem Ziel einsetzt, seinen Gewinn zu mehren“ und sich dabei „an das Gesetz und an die Spielregeln hält“. In erster Linie muss ein Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen auf internationalen Märkten wettbewerbsfähig sein. Die „Spielregeln“ jedoch, die Friedman in seinem vor über 50 Jahren verfassten Buch „Kapitalismus und Freiheit“ nennt, haben sich gewandelt. Die meisten Mitglieder einer modernen Gesellschaft (zu denen Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre und Politiker gehören) erwarten von einem Unternehmen heute wettbewerbsfähige finanzielle Ergebnisse – aber auch sozial verantwortliches, ökologisch nachhaltiges und politisch akzeptables Handeln. Was die Gesellschaft allerdings unter sozial verantwortlich, ökologisch nachhaltig und politisch akzeptabel versteht, lässt sich nicht immer genau definieren. Diese Begriffe unterliegen nicht nur großem Pluralismus, sondern auch permanentem Wandel. Nach sorgfältiger Prüfung muss das Unternehmensmanagement letztlich selbst entscheiden, wofür es sich in welchem Ausmaß zur Rechenschaft ziehen lassen will. Steht dies fest, muss es auf eine verständliche Weise kommuniziert werden.
Unternehmensverantwortung – die Pflicht: Keinen Schaden anrichten
Menschen überall auf dem Globus können noch so unterschiedliche Weltbilder haben und Lebensziele verfolgen – in Bezug auf das, was als gefährlich gilt und zu vermeiden ist, besteht globale Übereinstimmung. Daher fängt die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen damit an, Menschen keinen Schaden zuzufügen und schädliche Umwelteinflüsse zu minimieren (UNGC Prinzipien 3 – 9). Auch der Respekt der Menschenrechte (UNGC Prinzipien 1 und 2) sowie der Kamp gegen Korruption in all ihren Formen gehört zu den Minima Moralia anständigen Wirtschaftens. Um dies zu sichern sind eindeutig festgelegte Standards erforderlich, die in jedem Fall und an jedem Standort des Unternehmens gelten sowie Maßnahmen zu deren Einhaltung. Verantwortlich handelnde Unternehmen wissen seit langem, dass ausbeuterische oder die Gesundheit gefährdende Arbeitsbedingungen, mangelhafte Umweltstandards oder gar Menschenrechtsverletzungen inakzeptabel sind und handeln entsprechend. Der hippokratische Grundsatz „Vor allem schade nicht“ wird zunehmend auch auf die gesamte Wertschöpfungskette und andere Institutionen im Einflussbereich des Unter¬nehmens angewandt.
Wirkungsvolle Gesetze und Vorschriften auf nationaler Ebene sind wichtige Instrumente zur Vermeidung unternehmerischen Fehlverhaltens. Sich auf diese zu beschränken reicht allerdings in vielen Ländern nicht. Gesetze beschreiben ethische Mindeststandards, und zur Vermeidung von Schäden ist legales Handeln gemäß lokaler Gesetze nicht immer ausreichend. Verlässt man sich nur auf das Gesetz, fördert dies eine legalistische Einstellung, die sich auf das Einhalten von Vorgaben beschränkt. Weist das Gesetz Mängel oder Lücken auf, können sich auch gesetzestreu handelnde Unternehmen angreifbar machen.
Aber selbst Unternehmensrichtlinien, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen, und andere standardisierte Abläufe im Unternehmen können nicht in jedem Fall alle Herausforderungen abdecken. Damit auch bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten ein verantwortungsbewusstes Handeln möglich ist, sollten Manager eine Unternehmenskultur entwickeln helfen, in der moralische Reife und Zivilcourage des Einzelnen auf allen Hierarchieebenen gefördert werden. Unter solchen Voraussetzungen wird sich eine Unternehmenskultur entfalten, die viel mehr anstrebt, als nur „keinen Schaden anzurichten“.
Unternehmensverantwortung – die Kür: Das Richtige tun
Die seit etwa 2 Jahren Global Compact Leadership Initiative „LEAD“ geht weit über das „do no harm“ Prinzip hinaus und will, dass Unternehmen u.a. einen Beitrag an die Erreichung breiter definierter UNO Ziele leisten, z.B. durch Philanthropie, strategische soziale Investitionen oder Partnerschaften mit der UNO oder Nicht-Regierungsgesellschaften Da sich nicht allgemeingültig definieren lässt, was hier „das Richtige“ ist und Unternehmen beim besten Willen nicht alle gesellschaftlichen Erwartungen er¬füllen können, muss hier die Führungsebene die Forderungen der wichtigsten Anspruchsgruppen prüfen – und entscheiden, welche zusätzliche Verantwortungen man unter welchen Umständen und in welchem Ausmaß zu schultern bereit ist.
Was immer ein Unternehmen an zusätzlichen Leistungen für die Gesellschaft zu erbringen bereit ist, es sollte in der Nähe seiner Kern-Kompetenz sein, damit die ausreichende Urteilskraft für die Zusammensetzung des „richtigen“ Portfolios hat – für Pharmaunternehmen liegen solche Zusatzleistungen hauptsächlich im Gesundheitssektor armer Länder, bzw. bei der Erleichterung des Zugangs zu lebenswichtigen Medikamenten für kaufkraftarme Patienten, bei der Forschung zur Heilung von Armutsbedingten Krankheiten oder bei strategischen Investitionen zur Stärkung von defizitären Gesundheitssystemen .
Obwohl in modernen Gesellschaften die Dimension und Vielfalt der Ansprüche an (profitable!) Unternehmen größer ist als das, was auch das beste Unternehmen leisten kann, gibt es keinen Anlass für eine defensive Haltung: Im Wettbewerb bestehen und gleichzeitig Integrität wahren deckt sich im Wesentlichen mit guter Unternehmensführung. Zum Besten von Wirtschaft und Gesellschaft muss ein Gleichgewicht der Interessen angestrebt werden, ein faires Geben und nehmen beider Seiten. Zu einem solchen Gleichgewicht gehört, dass gesellschaftliche Aufgaben und Pflichten fair aufgeteilt werden – die Unternehmen dürfen nicht für die Lösung aller Probleme der Welt verantwortlich gemacht werden. Sie stellen jedoch eine Partei des „contrat social“ dar und sollten daher das Ihrige dazu beitragen.
Klaus Michael Leisinger, Gründer und Präsident der Stiftung Globale Werte Allianz, ist Professor für Soziologie an der Universität Basel (Spezialgebiete Entwicklungspolitik, Unternehmensethik und Corporate Responsibility), Sonderberater des Global Compact der Vereinten Nationen für Unternehmensethik und für die entwicklungspolitische Agenda nach Ablauf der Millenium-Entwicklungsziele- Periode (2015) und Mitglied des Globalen Aufsichtsrats der Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR) sowie Mitglied des Leadership Council des von UNO Generalsekretär Ban Ki-moon initiierten und Prof. Jeffrey Sachs geleiteten Sustainable Development Solutions Network.
Bildquellen:
- iStock_000053535254_Small: ©iStock.com/vitomirov